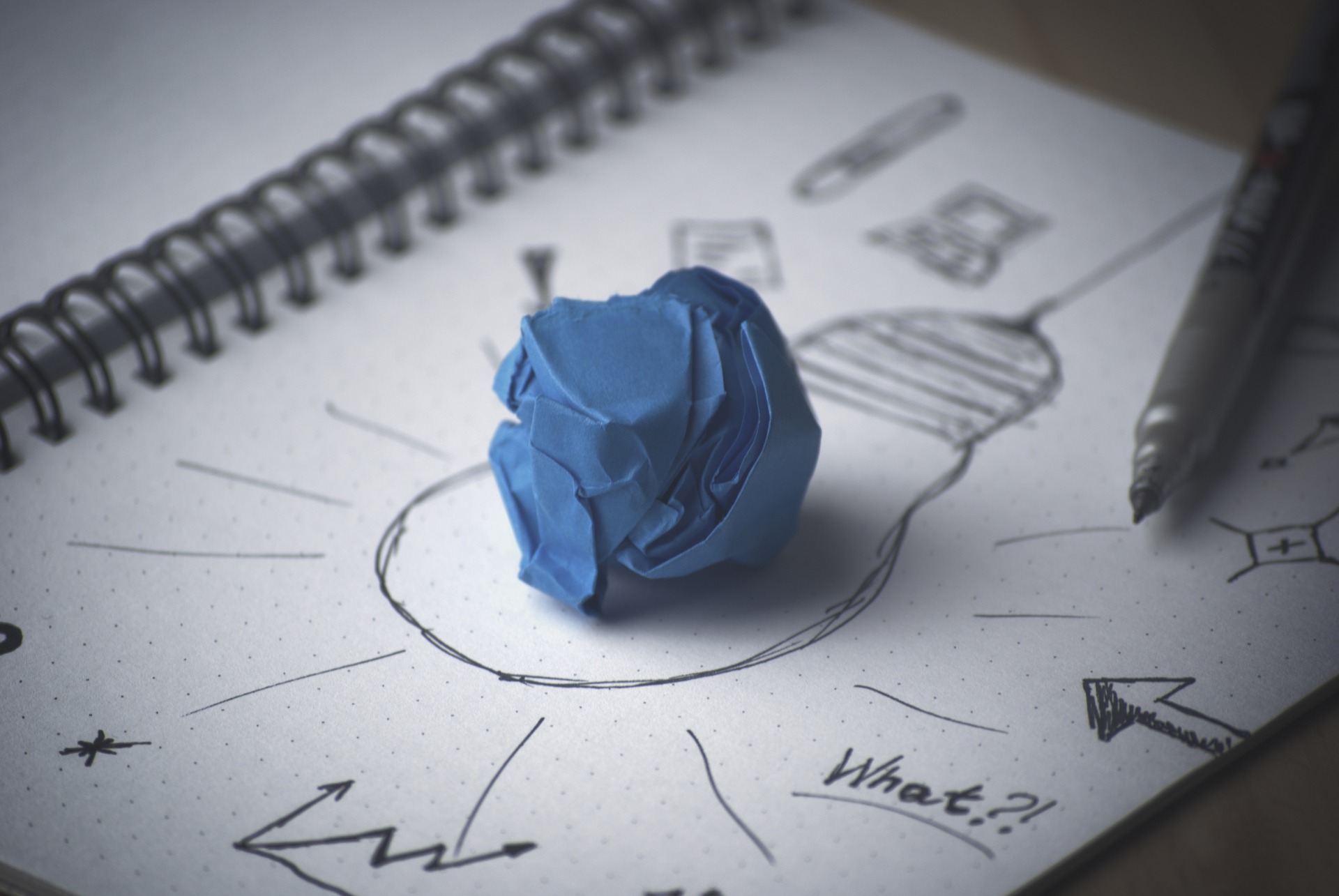Am 21. Juni 2019 war wieder einmal Zeit für die Fridays For Future Demonstrationen. Trotz der Pfingstferien waren auch an diesem Freitag Tausende Schülerinnen und Schüler, Eltern, Großeltern und viele andere mit ihnen auf die Straße gegangen. Auch in München fand wieder eine solche Demonstration statt, an der auch der zwölfjährige Max Gärtner teilnahm. Als ihn vor Ort eine Mitarbeiterin der Staatskanzlei zu einem Pressefoto mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder einlud, willigte er sofort ein. Stolz hielt Max sein selbstgebasteltes Schild mit der Aufschrift „Wir haben keinen Planeten B“ in die Kameras, als Söder ihm die Hand schüttelte und dabei sagte: „Deine Zukunft ist die Zukunft der Welt.“
Eine halbe Stunde später starb Max Gärtner, als ein unachtsamer Mitarbeiter der Staatskanzlei seinem SUV zurücksetzte, den Jungen übersah und ihn überrollte.
Die Meldung über Max‘ Tod erreichte in kürzester Zeit die Fridays For Future Demonstration, und aus dem fröhlichen Protestmarsch wurde ein Trauerzug.
Am nächsten Morgen versammelten sich viele Hundert Menschen zu einer Mahnwache vor der Staatskanzlei. Es war ein heißer, trockener Junitag, um 2,4 Grad wärmer, als im Durchschnitt der letzten 60 Jahre. Und als auch der Sommerabend lau und sternenklar zu werden versprach, beschlossen viele der Trauernden zu bleiben. Sie kampierten im Hofgarten und in der angrenzenden Fußgängerzone. Am nächsten Tag gingen sie nicht nach Hause. Aus Pietätsgründen und auch weil der bayerische Ministerpräsident sein Mitgefühl zeigen wollte, ließ die Polizei sie gewähren.
Am darauffolgenden Sonntag stellten die Münchner erstaunt fest, dass die spontane Sitzblockade nicht kleiner geworden, sondern auf etwa Tausend Personen angewachsen war. Natürlich war Sonntag, der letzte Tag der Pfingstferien, da konnte so etwas schon einmal passieren. Alle rechneten damit, dass sich die Versammlung spätestens am darauffolgenden Tag auflösen würde. Doch anstatt kleiner zu werden, zog die Menge im Laufe des Tages immer mehr Menschen an. Mehrmals versuchte die Münchner Polizei halbherzig, die Versammlung aufzulösen doch in Anbetracht der Masse an Menschen und ihrer durchaus friedlichen Grundhaltung, hielt sich die Polizei zurück. Bald schon war der gesamte Hofgarten ein einziges Lager. Wo am Vormittag auf der angrenzenden Residenzstraße noch normaler sonntäglicher Fuß- und Radverkehr stattgefunden hatte, kampierten am Nachmittag schon weitere Tausend Menschen. Sie sangen, diskutierten und aßen zusammen und luden Vorübergehende zum Verweilen ein. Sie forderten eine endgültige Veränderung der Politik. Max Gärtners tragisches Ende – so zufällig und sinnlos es gewesen war – stand stellvertretend für den Tod vieler Tausender Menschen, die jeden Tag an den Folgen der Klimakatastrophe starben. Doch damit musste jetzt Schluss sein.
Bald reichte die Sitzblockade bis zum Marienplatz und wuchs weiter die Fußgängerzone hinauf. Mit Fahnen, Transparenten, Broschüren und spontanen Vorträgen informierten die Demonstrierenden die angereisten Medien und die lokale Bevölkerung, und luden jeden ein, sich zu beteiligen. Viele gingen vorbei. Noch mehr setzten sich dazu und gingen nicht mehr fort.
Warum der bayerische Innenminister an diesem Sonntag nicht härter durchgriff, konnte vielleicht damit erklärt werden, dass seine beiden Töchter sowie seine Ehefrau an der Demonstration teilnahmen.
Am späten Abend fand in der Feldherrenhalle eine Kundgebung statt. Die Fridays For Future Bewegung, die Extinction Rebellion und sie unterstützende Gruppen kündigten an, dass sie auch am morgigen Tag den Platz nicht räumen würden. Stattdessen riefen sie zum Generalstreik auf:
„Es hat keinen Sinn mehr, noch länger darauf zu warten, dass die Politik von sich aus zur Vernunft kommt. Seit Jahrzehnten wissen die Politikerinnen und Politiker, was mit unserem Planeten passiert und trotzdem ist niemand bereit, wirklich zu handeln. Wenn uns die Politik nicht vor den katastrophalen Folgen der Klimakrise schützen will, dann müssen wir es selbst tun. Friedlich, aber unnachgiebig. Diesmal werden wir nicht zurückweichen. Es gibt keine Alternative mehr. Entweder eine ökologische Revolution oder der Untergang unserer Spezies.“
Diese Rede hörten Tausende Menschen live und Millionen im Netz.
Als am 24. Juni die Sonne über München aufging, stand die Stadt still. Keine U-Bahn, keine Tram, kein Bus und kein Taxi rollte durch die Stadt. Aus den Außenbezirken strömten Menschen in die Innenstadt, bepackt mit Schlafsäcken, Zelten und Lebensmitteln. Die Anwohnerinnen und Anwohner verteilten Kaffee und belegte Brote. Mobile Kuchentrupps beruhigten Leute, die in ihren Autos festsaßen, Trommelgruppen unterhielten die Menge. Lokale Radiosender schickten Reporterteams durch das Camp, um die Stimmung einzufangen. Überall hörte man Musik, oder politische Diskussionen, Essen wurde gemeinsam zubereitet und Nachrichten über die aktuelle Ausbreitung der Sitzblockade geteilt, der einzige Notarzteinsatz war die vorzeitige Geburt des jüngsten Demonstranten. Doch das war erst der Anfang.
Im Laufe der nächsten Tage schlossen sich immer mehr Menschen in immer mehr Städten dem Generalstreik an. Die Forderungen waren einfach und klar wie nie: Eine vollständige Abkehr vom bisherigen Kurs. Alle politischen Entscheidungen sollten sich am unmittelbaren Klimanotstand orientieren und ihn bekämpfen. Alle Gesetze, alles öffentliche Engagement, die ganze Kraft des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft sollten einem Ziel untergeordnet werden: Dem Überleben der Menschheit.
Ausländische Medien, die bisher nur sporadisch über die bayerischen Hippies berichtet hatten, wurden nun aufmerksamer. Die Regierung in Berlin reagierte noch zurückhaltend und sprach von einem vorübergehenden Hype. Doch sie sollte sich irren. Nur wenige Tage später ging auch in Berlin nichts mehr. Die Menschen setzten sich auf die Straße und blieben dort. Immer mehr Fotos, Videos, Nachrichten und Aufrufe wurden veröffentlicht und geteilt. Der Hashtag #ClimateStrike trendete auf allen Social-Media-Kanälen. Es war so einfach, so logisch und gleichzeitig mächtiger als jede andere Strategie: Die Büros blieben leer, die Fabrikhallen standen still, die Züge ruhten in ihren Depots. Anstatt zur Arbeit zu gehen, setzten die Menschen sich auf die Straße und blieben dort. Wie ein Lauffeuer breitete sich der Generalstreik in den Hauptstädten der Welt aus. Wie ein unsichtbarer Magnet zogen die Leute von ihren Häusern und Wohnungen auf die Straßen der Städte, setzten sich hin und blieben dort.
Und mit einem Mal geriet die vermeintlich unaufhaltsame Maschine der Weltwirtschaft ins Stocken. Es war, als seien die Uhren unvermittelt stehen geblieben, als hätte jeder plötzlich den einen entscheidenden Impuls verspürt, der das „möglicherweise“ in ein „tatsächlich“ verwandelte.
Natürlich gab es Länder, in denen der Streik auf Widerstand stieß. In Barcelona explodierte eine Bombe mitten auf einem voll besetzten Marktplatz; in einem Vorort von Moskau richteten Polizeieinheiten ein Blutbad unter den Demonstrierenden an. In den USA wurden mehrere Hundert Streikende von selbsternannten Heimatschützern erschossen. In China schaltete die Kommunistische Partei für zehn Tage das Internet ab, damit sich die Menschen nicht organisieren und keine Bilder nach außen dringen konnten. Im Iran versuchten Trupps der Religionspolizei, streikende Frauen zu verhaften, und wurden daraufhin von der aufgebrachten Menge gelyncht. In Pakistan starben viele Streikteilnehmende durch ein Feuer, das sich durch die provisorischen Zelte fraß.
Weltweit versuchten Politikerinnen und Politiker, das Ende des Streiks herbeizureden: „Der globale Klimastreik wird scheitern“, „Bald werden die Demonstranten aufgeben“, „Fridays For Future ist am Ende“, „Der Streik frisst seine Kinder“!
Doch die Menschen gingen auf die Straße und blieben sitzen. Auch nach drei Wochen blockierten sie weiterhin die Metropolen der Welt und sorgten dafür, dass der Motor des Globitalismus, zum ersten Mal seit Beginn der Industrialisierung, vollkommen zum Stillstand kam.
Nach dem Blackout kehrte auch China wieder zurück. Es war geschunden, es war verletzt, doch die Protestbewegung hatte sich durchgesetzt. Am Ende war es der KP nicht gelungen, das Militär noch einmal auf friedlich demonstrierende Menschen loszulassen. Xi Jinping war abgesetzt und die KP durch ein neu ausgerufenes Volks-Komitee ersetzt worden. Die Nachricht versetzte die Welt in Aufruhr. Wenn es in China möglich war, war es überall möglich. Von Panik ergriffen verschanzten sich die Machthaber der Welt – gewählte wie selbsternannte – in ihren Verwaltungsgebäuden, Palästen und Bunkern. Sie riefen Polizei, Militär und alle Macht des Staates zu Hilfe, um sich vor dem Zorn und der Macht des Volkes zu schützen. Doch es half nichts. Die Menschen hatten gesehen, was möglich war, jetzt konnte es Wirklichkeit werden.
Eine Regierung nach der anderen lenkte ein. Viele Staats- und Regierungschefs traten zurück, andere wurden von der Bevölkerung zum Rücktritt gezwungen, und manche Autokraten verschwanden für immer. Viele Staaten nutzen den Prozess für eine demokratische Erneuerung. Klima-Kabinette wurden gebildet, die mit Hilfe renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue demokratische Wirtschafts- und Politikmodelle erarbeiteten, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Alles politische Handeln wurde dem einen Ziel untergeordnet: die Menschheit vor dem Klimakollaps zu bewahren. Viele Länder fanden ihre eigene Strategie, einige kooperierten, andere kapselten sich ab. Eines aber taten sie alle: Sie erklärten die kapitalistische Weltwirtschaft für beendet. Wachstum sollte nicht länger das Ziel sein, das GDP nicht länger der Vergleichsfaktor der Staaten untereinander. Stattdessen sollte ab sofort der kleinstmögliche jährliche CO2 Nettoemissionswert angestrebt werden. Die Medien befürchteten gesellschaftliche Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände nach der vorläufigen Stilllegung ganzer Industriezweige. Doch es gab eine Vielzahl von Ideen, um den darin Beschäftigten eine neue Existenzgrundlage zu bieten. Allen war klar: Ein Zurück zur alten Lebensweise war nicht möglich. Die alten Gesellschaftsmodelle, die Wirtschaftswachstum durch Ausbeutung von Mensch und Natur ermöglicht hatten, mussten ersetzt werden. Eine neue Weltgesellschaft war geboren, die sich verpflichtete, gerechter, solidarischer und achtsamer mit den ihr zur Verfügung stehenden begrenzten Ressourcen umzugehen. Monokulturen mussten durchmischt, Wälder aufgeforstet, Gewässer gesäubert und Fischgründe geschützt werden. Internationale Lieferketten und der globale Flugverkehr mussten neu überdacht, gesellschaftliche Mobilität sinnvoll organisiert werden. Energie wurde bis auf Weiteres zum raren Gut. Tausend und mehr scheinbar unlösbare Aufgaben standen uns noch bevor. Doch eines hatten wir alle gemeinsam erreicht: Die Rettung des Planeten.
Ach, du wendest ein, das alles hat gar nicht stattgefunden? Der Juni 2019 ist vorübergegangen und wir befinden uns noch immer in einer Welt, die blind konsumiert und dabei Mensch und Natur in den Abgrund stürzt? Wie schade. Für einen Augenblick hatte ich gedacht, dass wir gemeinsam etwas erreicht hätten. Als Menschen, die wir alle den gleichen Traum teilen und keinen zweiten Planeten haben, auf den wir fliehen können.
Es hat sich so leicht angehört, so selbstverständlich. Einfach auf die Straße setzen und nicht mehr weggehen, bis die Welt zur Vernunft kommt. Wir alle. Ernsthaft, kompromisslos, hingebungsvoll. Denn wenn wir das nicht schaffen, wer soll uns sonst retten? Wer, wenn nicht wir? Wenn nicht jetzt, wann dann?
Am 20. September 2019 haben wir wieder eine Chance. Es könnte anfangen mit einer Demonstration, mit einem weltweiten Streik. Was, wenn wir einfach nicht aufhören? Was, wenn wir diesmal sitzen bleiben?